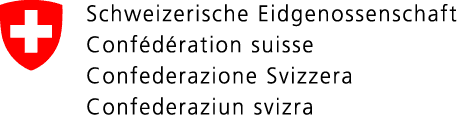Es gab doch auch gute Pflegeplätze?
Ob es früher nicht auch Pflegeplätze gab, an denen es Kindern und Jugendlichen gut ging, ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Die Antwort ist: Ja, es gab auch gute Pflegeplätze, aber leider viel zu wenige.
Mit jeder neuen Studie und jedem erzählten Lebensbericht verdichtet sich das Bild für die Schweiz: Missstände in Heimen und an Pflegeplätzen waren keine Ausnahme, sondern stellten eher die Regel dar.

Mit einer Fremdplatzierung erhöhte sich das Risiko, von Gewalt, Ausbeutung, Missbrauch, erneuter Platzierung und Entwurzelung betroffen zu sein. Die Kinder und Jugendlichen waren an den Pflegeplätzen häufig von der Aussenwelt abgeschnitten, hatten keine stabilen sozialen Beziehungen und befanden sich in einem ausgeprägten Abhängigkeitsverhältnis. Oft waren sie vorverurteilt: Kamen sie in ein Heim oder in eine «Erziehungsanstalt», haftete ihnen schon beim Eintritt das Etikett an, «schwierig» zu sein. Dennoch gab es auch Plätze, an denen Kinder und Jugendliche positive Erfahrungen machten.

Positive Erfahrungen
So berichten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen etwa, dass es ihnen am Pflegeplatz besser ging als zu Hause. Denn nicht vergessen werden darf: Auch in der eigenen Familie kam und kommt es bis heute zu Gewalt und Vernachlässigung von Minderjährigen. Ein Pflegeplatz konnte eine belastende Situation verbessern und das Wohlergehen eines Kindes schützen. Einige Betroffene erinnern sich, dass sie an ihrem Pflegeplatz eine zugewandte Erziehung und Liebe erhielten, dass sie spielen und eine gute Ausbildung machen konnten. Manche wurden auch später noch von ihren Pflegeeltern unterstützt. Sicher ist, dass dies von Pflegefamilien viel Zeit, Kraft und Zuwendung verlangte. Von Seiten des Staats erhielten Pflegeeltern kaum Unterstützung.
Es gab auch Kinder und Jugendliche, die in Heimen gute Erfahrungen machten. Im Rückblick berichten sie als Erwachsene etwa von einer stabilen Beziehung zu einem Gruppenleiterpaar, dass sie Freizeit hatten und eine fördernde Schulbildung erhielten. Viele Betroffene berichten zudem, dass sie auch ausserhalb von Institutionen Menschen begegneten, die ihnen Wertschätzung entgegenbrachten. Sie schildern beispielsweise, wie eine Fürsorgerin oder eine Betreuungsperson sie in einem entscheidenden Moment ernst nahm, ihnen zuhörte und an sie glaubte. Während das übrige Umfeld den Kindern und Jugendlichen häufig vermittelte: «Du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts werden», halfen diese Menschen ihnen, Vertrauen in sich selbst zu fassen, richtige Entscheidungen zu treffen und buchstäblich zu überleben.
Zeitgeist als Argument greift zu kurz

Diese Bandbreite an Erfahrungen zeigt, dass eine gewaltfreie und kindgerechte Erziehung auch damals möglich war. Das häufig vorgebrachte Argument, es habe keine Alternative zu gewalttätigen Erziehungsformen gegeben, greift daher zu kurz. Wer sich auf den damaligen Zeitgeist beruft, um Missstände in Institutionen und Pflegefamilien als alternativlos darzustellen, verharmlost die Geschichte der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen. Zwar fehlten vielen Heimen die Mittel, um genügend und qualifiziertes Personal anzustellen, was zu einer Überforderung der Mitarbeitenden führte. Doch auch unter diesen Bedingungen lässt sich weder das Ausmass der Gewalt rechtfertigen noch die von vielen Heimleitungen mitgetragene Erziehungskultur, die von Drill, Demütigung und teils massiven Übergriffen geprägt war.