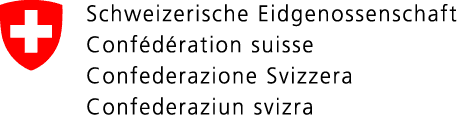Wissenschaftliche Aufarbeitung
Die Forschung ist ein zentraler Bestandteil der Aufarbeitung und ein wichtiges Anliegen von Betroffenen. Sie zeigt, warum es fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen gab, wer sie anordnete und wie sie umgesetzt wurden. Die wissenschaftliche Aufarbeitung trägt dazu bei, das erlittene Unrecht und seine Folgen zu verstehen.

Kritischer Blick auf fürsorgerische Zwangsmassnahmen
Bereits früh im 20. Jahrhundert wurden wissenschaftliche Arbeiten zu fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen publiziert. Diese betrachteten die Betroffenen jedoch meist nur als Objekte und dienten vielfach dazu, die angewandten Zwangsmassnahmen zu rechtfertigen. Erst seit den 1980er-Jahren untersuchen wissenschaftliche Studien solche Massnahmen kritisch. Heute beschäftigen sich verschiedene Disziplinen damit: von der Geschichte und den Sozialwissenschaften über die Soziale Arbeit bis hin zur Psychologie und den Rechtswissenschaften. Die Perspektiven und Erfahrungen der Betroffenen gelten dabei als wichtige Expertise und fliessen in die Forschung ein. Partizipative Ansätze gewinnen an Bedeutung. Betroffene wirken aktiv am Forschungsprozess mit und unterstützen zum Beispiel die Entwicklung von Fragestellungen.
Unterschiedliche Forschungsfelder
Die Forschung zu fürsorgerischen Zwangsmassnahmen konzentriert sich oft auf bestimmte Gruppen von Betroffenen. So wurde bereits früh untersucht, wie das «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse» der Stiftung Pro Juventute in das Leben jenischer Familien eingriff. Ein eigenes Forschungsfeld bildeten Studien zu Eugenik und Zwang in der Psychiatrie und im Vormundschaftswesen. Später rückten Themen wie das Verdingkinderwesen, die Heimerziehung oder die administrative Versorgung Erwachsener in «Arbeitsanstalten» in den Fokus. Heute werden weitere Bereiche erforscht, darunter Unterbringungen in «Armenhäusern», inländische und internationale Zwangsadoptionen oder die Folgen des Saisonnierstatuts für Familien und ihre Kinder.

Kleinkinder auf der Terrasse des Heims Alpenblick in Hergiswil.
Es gab wenig Personal und sehr viele Kleinkinder zu betreuen. Die Pflegeschwestern und die Pflegeschülerinnen versuchten ab den 1960er-Jahren, Erkenntnisse der Forschung des "Instituts für Psychohygiene im Kindesalter", 1957 gegründet von der Kinderpsychiaterin und Kleinkindforscherin Marie Meierhofer, umzusetzen und die Betreuungsbedingungen zu verbessern.
Bild: Privatbesitz. Quelle: Privatbesitz.

Jenische Mutter mit Kind
Der staatliche Eingriff in jenische Familien mithilfe des "Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse" der Stiftung Pro Juventute war massiv. Diese Eingriffe wurden von der Forschung schon früh untersucht.
Bild: Hans Staub. Quelle: 1978.999.559, © Hans Staub / Fotostiftung Schweiz.

Innenansichten der psychiatrischen Klinik Waldau oder Münsingen 1948
Das Bild wurde vermutlich 1948 von Walter Nydegger für den Berner Regierungsrat aufgenommen. Die Forschung zur Geschichte der Psychiatrie stellt ein wichtiges Forschungsfeld der Aufarbeitung fürsorgerischer Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen dar.

Kartoffelnsetzen im Entlebuch, Romoos, 1941
Verding- und Heimkinder mussten oftmals schwere Arbeit leisten und erlebten häufig Gewalt, Ausbeutung und Vernachlässigung. Die interdisziplinäre Forschung zur Geschichte dieser Kinder ist sehr breit aufgestellt.
Bild: Theo Frey. Quelle: 2007.55.037, © Theo Frey / Fotostiftung Schweiz.
Seit etwa 2010 kamen regionale Studien zu einzelnen Kantonen und Gemeinden hinzu. Auch verschiedene Institutionen begannen verstärkt, ihre eigene Vergangenheit wissenschaftlich aufzuarbeiten. Auf nationaler Ebene lief bereits zwischen 2003 und 2007 das Nationale Forschungsprogramm NFP 51 Integration und Ausschluss, das sich mit gesellschaftlichen Ausgrenzungsprozessen beschäftigte, die auch bei fürsorgerischen Zwangsmassnahmen wirkten. Später untersuchte die Unabhängige Expertenkommission (UEK) von 2014 bis 2019 administrative Versorgungen, also ausserstrafrechtliche Versorgungen in «Arbeits-» und anderen «Anstalten». Daran knüpfte das Nationale Forschungsprogramm NFP 76 Fürsorge und Zwang (2017–2024) an, das sich unter anderem mit den langfristigen Folgen zwangsfürsorgerischer Massnahmen sowie der heutigen Anwendung von Zwang im Sozialbereich befasste. Auch die Landeskirchen haben begonnen, ihre Beteiligung an den fürsorgerischen Zwangsmassnahmen aufzuarbeiten.
Bedeutung der wissenschaftlichen Aufarbeitung
Die Forschung zu fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen zeigt, auf welche Weise diese Massnahmen bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts fester Bestandteil der schweizerischen Sozialpolitik waren. Für das 19. und 20. Jahrhundert wird von mehreren Hunderttausend Betroffenen ausgegangen.
Wissenschaftliche Studien sind ein zentraler Bestandteil gesellschaftlicher Aufarbeitung. Sie liefern die empirischen Grundlagen für politische Anerkennung und tragen zur Veränderung des kollektiven Gedächtnisses und einer Erinnerungskultur bei, die alle einschliesst. Zudem hinterfragen sie traditionelle Geschichtsbilder und relativieren Vorstellungen einer besonders fortschrittlichen und demokratischen Schweiz. Nicht zuletzt wirft die Forschung immer wieder neue Fragen auf. Sie beleuchtet Themen aus veränderten Blickwinkeln und regt mit ihren Antworten an, den Rechtstaat sowie die heutige Praxis im Sozialbereich und im Kindes- und Erwachsenenschutz kritisch zu reflektieren.