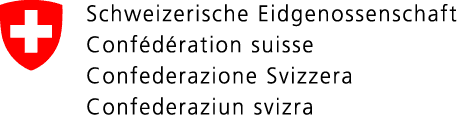Staatliche Aufarbeitung
Die Aufarbeitung fürsorgerischer Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen setzte in der Schweiz ab den 1990er Jahren ein. 1986 bat erstmals ein Bundesrat für die systematischen Kindswegnahmen aus jenischen Familien um Entschuldigung und leitete eine Aufarbeitung ein. Im Anschluss kam es zu verschiedenen politischen Vorstössen im Bundesparlament, die unterschiedliche Zwangsmassnahmen betrafen. 2010 richtete eine Bundesrätin die Bitte um Entschuldigung an administrativ versorgte Menschen. 2013 fand schliesslich ein nationaler Gedenktag in Bern statt und ein Runder Tisch wurde eingesetzt, um eine umfassende Aufarbeitung vorzubereiten. Seit 2017 verfügt die Schweiz über eine gesetzliche Grundlage für die Aufarbeitung fürsorgerischer Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen.

Kindswegnahmen aus jenischen Familien
Kritik an fürsorgerischen Zwangsmassnahmen gab es schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Erst der wirtschaftliche Aufschwung und der Ausbau des Sozialstaates nach dem Zweiten Weltkrieg sowie der gesellschaftliche Wandel führten jedoch zu einer schrittweisen Praxisänderung und zu Anpassungen der Gesetzesgrundlagen. Zu Beginn der 1970er-Jahre berichteten die Medien erstmals über das systematische Auseinanderreissen jenischer Familien.
Diese Berichterstattung, in der Jenische den Staat zur Verantwortung zogen, ermöglichte eine öffentliche Debatte und bewirkte 1973 die Auflösung des «Hilfswerks für die Kinder der Landstrasse». Nach langem und teilweise erbittertem Kampf fanden die Jenischen endlich auch Gehör im Parlament. 1986 entschuldigte sich der damalige Bundespräsident Alphons Egli dafür, dass der Bund das «Hilfswerk» der Stiftung Pro Juventute mitfinanziert und damit schweres Leid verursacht hatte. 1987 entschuldigte sich auch die Pro Juventute. 1988 wurde eine Akten- und Fondskommission eingesetzt mit dem Ziel, den betroffenen Jenischen die Einsicht in ihre Akten zu ermöglichen. Bis 1992 wurden zudem finanzielle Entschädigungen an die Opfer von je maximal 20'000 Franken ausgerichtet. Die Akten sind im Schweizerischen Bundesarchiv aufbewahrt.
Ringen um Anerkennung des Unrechts und Leids
Andere Betroffene von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen rangen weiterhin um Anerkennung des erlebten Unrechts und Leids. Einzelne exponierten sich mit ihren erschütternden Lebensgeschichten und setzten sich entschlossen für eine Anerkennung und Wiedergutmachung ein. Der Zusammenschluss von Betroffenen in Organisationen und die zunehmende gesellschaftliche Sensibilisierung für Opferrechte ermöglichten schliesslich einen Umschwung. Politikerinnen und Politikern reichten auf Anregung von Betroffenen Vorstösse in den Parlamenten ein. Mit Unterstützung von Personen aus Kultur, Forschung und Medien erwirkten sie eine öffentliche Auseinandersetzung. Auch waren bereits einige wissenschaftliche Studien erschienen, die bekräftigten, was betroffene Personen berichteten: Es handelte sich nicht um einzelne tragische Schicksale, sondern um Eingriffe ins Leben, von denen in der ganzen Schweiz Hunderttausende betroffen waren.
Der Staat übernimmt Verantwortung
Die Schweiz ist nicht das einzige Land, das sich diesem dunklen Kapitel ihrer Geschichte stellt. Der politische Aufarbeitungsprozess erwies sich aber aufgrund der kantonalen und kommunalen Zuständigkeiten für fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen als herausfordernd. Der Bund übernahm zusammen mit den Kantonen schliesslich die Verantwortung und ermöglichte einen nationalen Prozess der Rehabilitierung und der Ankerkennung des Unrechts, von dem Menschen in allen Landesteilen betroffen waren. Möglich wurde diese Aufarbeitung, weil sich Betroffene jahrzehntelang beharrlich dafür eingesetzt hatten und mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit getreten waren.
2010 bat Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf an einem Gedenkanlass in der Frauenstrafanstalt Hindelbank gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Kantone um Entschuldigung. Die Entschuldigung richtete sich an alle Personen, die ohne strafrechtliche Verurteilung von Behörden in Anstalten eingewiesen worden waren. Das war 30 Jahre nachdem die kantonalen Rechtsgrundlagen zur administrativen Versorgung 1981 durch die neuen Bestimmungen zur fürsorgerischen Freiheitsentziehung (FFE) im ZGB abgelöst wurden.
Im April 2013 fand ein nationaler Gedenkanlass in Bern statt. Die damalige Bundesrätin Simonetta Sommaruga sowie Vertretungen der Kantone, der Landeskirchen und von Verbänden baten vor rund 700 Betroffenen um Entschuldigung für das ihnen zugefügte Unrecht und Leid. Darunter waren Personen, die als Kinder auf Bauernhöfen als Arbeitskräfte ausgebeutet oder in Heimen und Anstalten misshandelt worden waren, die Zwangsmassnahmen in der Psychiatrie erlebt hatten oder die gezwungen worden waren, ihr Kind zur Adoption zu geben. Dieser Gedenkanlass markierte den Anfang einer umfassenden nationalen Aufarbeitung. Die Bundesrätin setzte dafür einen Runden Tisch für alle Opfer von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen ein. Die Kantone beauftragten Opferhilfestellen mit der Beratung betroffener Personen und die Staatsarchive begannen, die Betroffenen bei der Aktensuche zu unterstützen.
Im September 2013 verabschiedete das Parlament das Bundesgesetz über die Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen, das am 1. August 2014 in Kraft trat. Es beinhaltete die Anerkennung des Unrechts und bildete die Grundlage für die wissenschaftliche Aufarbeitung der administrativen Versorgungen, regelte die Archivierung und Akteneinsicht, schloss aber ausdrücklich finanzielle Leistungen für die Opfer aus. Doch es blieb nicht dabei, weitere Massnahmen wurden ergriffen.
Gesetzliche Grundlage für eine umfassende Aufarbeitung
Der bereits erwähnte Runde Tisch hatte den Auftrag, eine umfassende Aufarbeitung vorzubereiten, Massnahmen in die Wege zu leiten und zu begleiten. Daran beteiligt waren sowohl Betroffene und Vertretungen von Betroffenenorganisationen als auch Vertretungen von Behörden, Institutionen und Organisationen. Ein Fonds für Soforthilfe für Betroffene in Notlagen wurde eingerichtet. Der Bericht des Runden Tischs mit Empfehlungen zur historischen, rechtlichen, gesellschaftspolitischen Aufarbeitung sowie finanzieller Leistungen bildete eine wichtige Grundlage für die Ausarbeitung der künftigen Gesetzesvorlage.
Dazu beigetragen, dass den Worten auch Taten folgten, hatte insbesondere auch die von Guido Fluri zusammen mit einem breiten Unterstützungskomitee 2014 lancierte «Wiedergutmachungsinitiative». Sie forderte eine offizielle Anerkennung des Unrechts, welches den Opfern zugefügt wurde, die Auszahlung eines Solidaritätsbeitrags, eine wissenschaftliche Aufarbeitung sowie Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Das Parlament nahm schliesslich den Gegenvorschlag des Bundesrats an, der die Kernanliegen der Initiative berücksichtigte und darüber hinaus unter anderem die Archivierung und Akteneinsicht regelte sowie das Beratungs- und Unterstützungsangebot für Betroffene und Opfer gesetzlich verankerte. Durch die Annahme des Gegenvorschlags des Bundesrates konnten die Aufarbeitungsmassnahmen wesentlich rascher umgesetzt werden.

Am 1. April 2017 trat das Bundesgesetz über die Aufarbeitung fürsorgerischer Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981, kurz AFZFG, in Kraft. Es löste das oben genannte Bundesgesetz über die Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen von 2014 ab. Aufgrund des AFZFG können Opfer einen Solidaritätsbeitrag von 25‘000 Franken beantragen. Als Opfer im Sinne des Gesetzes gelten Personen, deren körperliche, psychische oder sexuelle Unversehrtheit oder deren geistige Entwicklung durch fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen unmittelbar und schwer beeinträchtig worden ist. Zudem regelt das Gesetz unter anderem die Akteneinsicht für Betroffene, die wissenschaftliche Aufarbeitung und deren Vermittlung an die breite Öffentlichkeit und regt die Schaffung von «Zeichen der Erinnerung» durch die Kantone an.
Öffentliches Bewusstsein für begangenes Unrecht
Angestossen durch das Bundesgesetz beteiligten sich auch Kantone und Gemeinden, sowie Organisationen und Stiftungen an der Aufarbeitung. Als «Zeichen der Erinnerung» richteten sie Gedenkstätten ein, beteiligten sich an Ausstellungen, gaben wissenschaftliche Studien in Auftrag und schafften in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für das begangene Unrecht. Seit 2023 zahlt die Stadt Zürich einen zusätzlichen Solidaritätsbeitrag aus, sofern städtische Behörden oder Heime involviert waren. Weitere Gemeinden und auch Kantone wie Schaffhausen und Zürich wollen dem Beispiel folgen.
Das systematische Vorgehen gegen die Jenischen hat der Bundesrat im Februar 2025 aufgrund eines Rechtsgutachtens nach Massgabe des aktuellen Völkerrechts als «Verbrechen gegen die Menschlichkeit» anerkannt. Die rassistisch motivierten Kindswegnahmen aus jenischen Familien stellen aus heutiger Sicht einen besonders schwerwiegenden Verstoss gegen die Menschenrechte dar. Der Bund setzt sich aktuell zusammen mit den Jenischen und Sinti über die weiteren Schritte auseinander.

Die Aufarbeitung fürsorgerischer Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen findet weiterhin auf allen staatlichen Ebenen statt. Zudem haben private, gesellschaftliche und kirchliche Organisationen und Institutionen damit begonnen, sich mit ihrer Geschichte auseinanderzusetzen und sind in Austausch mit Betroffenen getreten.