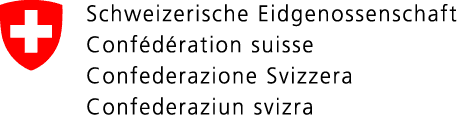In Kürze
Gestern. Ein Überblick
Bis Ende des 20. Jahrhunderts griffen Behörden in der Schweiz mit sogenannten «fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen» tief in das Leben von hunderttausenden von Menschen ein. Die Massnahmen wurden im Namen der Fürsorge angeordnet. Das Ziel war es, Armut zu bekämpfen und soziale Ordnung herzustellen. Doch das führte zu grossem Unrecht und Leid.
Zu den häufigsten Massnahmen gehörten die Fremdplatzierung von Kindern und Jugendlichen in Heimen, Erziehungsanstalten oder Pflegefamilien. Viele mussten als Verdingkinder auf Bauernhöfen oder in Betrieben schwere Arbeit leisten. Betroffen waren auch die Minderheit der Jenischen und Sinti, deren Kinder von Behörden und Hilfswerken aus den Familien gerissen und in Pflegefamilien oder Kinderheimen platziert wurden.
Sehr verbreitet war auch, dass Erwachsene ohne Gerichtsurteil in Armenhäuser, Arbeitserziehungsanstalten oder psychiatrische Kliniken eingewiesen wurden. Die Bezeichnung dafür lautet «administrative Versorgung». An manchen wurden Medikamentenversuche durchgeführt. Viele wurden auch gegen ihren Willen unfruchtbar gemacht oder gezwungen ihre Kinder zur Adoption freizugeben.
Betroffene waren zum Teil schlimmster psychischer, körperlicher und sexualisierter Gewalt ausgesetzt, erlitten Hunger, gesundheitliche Vernachlässigung oder wurden wirtschaftlich ausgebeutet.
Behörden, Kirchen und Private trugen die Verantwortung für dieses Leid. Sie bildeten ein unübersichtliches Fürsorgesystem, das von strengen Moralvorstellungen, fehlender Aufsicht und Kostenüberlegungen bestimmt war. Mitverantwortlich ist auch die Gesellschaft, die schweigend zusah oder wegschaute.
Es gab auch Ausnahmen. Manche Kinder und Jugendliche machten gute Erfahrungen in Heimen oder Pflegeplätzen und wurden dadurch gestärkt. Doch gerade das zeigt: es wäre auch im damaligen Umfeld möglich gewesen, gute Bedingungen zum Wohl der Kinder zu schaffen.
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nahm die Zahl der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen immer mehr ab. Kritik wurde laut, die Armut ging zurück und die Gesellschaft öffnete sich. Nachdem die Schweiz der Europäischen Menschenrechtskonvention beigetreten war, wurde die administrative Versorgung 1981 abgelöst. An ihre Stelle trat die fürsorgerische Freiheitsentziehung, die einen verbesserten Rechtsschutz für die betroffenen Personen brachte. Die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen bezieht sich daher auf die Zeit vor 1981.
Heute. Folgen und Aufarbeitung
Fürsorgerische Zwangsmassnahmen hatten für Betroffene sehr häufig einschneidende Folgen, die ihr Leben dauerhaft prägten. Sie wirken bei den Betroffenen und ihren Nachkommen bis heute nach.
Die Forschung zeigt, dass Menschen mit Gewalterfahrungen häufig unter psychischen Erkrankungen, chronischen Schmerzen, finanziellen Schwierigkeiten, schlechteren Ausbildungen und sozialer Ausgrenzung leiden. Die Folgen für die Gesellschaft sind zum Beispiel höhere Gesundheitskosten und soziale Ungleichheit.
Eine breite politische Auseinandersetzung mit dem Thema setzte in der Schweiz in den 1990er-Jahren ein. Seit 2017 verfügt die Schweiz mit dem «Bundesgesetz über die Aufarbeitung der fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen» über eine gesetzliche Grundlage, die das Unrecht und das erlittene Leid anerkennt und einen Solidaritätsbeitrag für Opfer ermöglicht.
Kantone und Gemeinden, aber auch die Landeskirchen, weitere Organisationen und Stiftungen beteiligen sich ebenfalls an der Aufarbeitung. Sie errichten Gedenkstätten und schaffen in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für das begangene Unrecht.
Im Rahmen der Aufarbeitung werden fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen auch wissenschaftlich untersucht. Unter anderem analysierten zwei grosse nationale Forschungsprojekte die Thematik über Jahre hinweg. Die Forschungsresultate sind öffentlich zugänglich, zum Beispiel über die Datenbank dieser Web-Plattform.
Nicht nur in der Schweiz wird das historische Unrecht aufgearbeitet. International zeigt sich: Trotz unterschiedlichen Ausgangslagen ähneln sich die Mechanismen, die Erlebnisse der Betroffenen und die Arten der Gewalt stark.
Viele Länder bemühen sich um eine Veränderung ihrer Erinnerungskultur. Menschen, die früher systematisch an den Rand gedrängt und benachteiligt wurden, sollen zu Wort kommen und einen Platz in der Gesellschaft und im gemeinsamen kulturellen Gedächtnis erhalten.
Und morgen? Anerkennen, Vermitteln, Umdenken
Nicht nur Betroffene und ihre Angehörigen spüren die Folgen fürsorgerischer Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen, sondern auch die heutige Gesellschaft. Durch die Auseinandersetzung mit der Geschichte erhalten wir aber auch die Chance, aus vergangenen Fehlern zu lernen.
Der Bund zahlt Opfern von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen einen Solidaritätsbeitrag von 25‘000 Franken. Dieser Solidaritätsbeitrag ist eine symbolische Anerkennung des erlittenen Unrechts und ermöglicht vielen Opfern, sich zum ersten Mal im Leben einen grösseren Wunsch zu erfüllen. Er ist jedoch keine Entschädigungszahlung, die die Lebensumstände nachhaltig verbessern könnte.
In jedem Kanton gibt es Anlaufstellen und Archive, die Betroffene beim Beantragen des Solidaritätsbeitrags und der persönlichen Aufarbeitung ihrer Geschichte unterstützen.
Besonders wichtig ist es, dass dieses Kapitel der Schweizer Geschichte allen bekannt ist, auch den kommenden Generationen. Deshalb spielt die Vermittlung eine wichtige Rolle. Das Programm «erinnern für morgen», zu dem auch diese Web-Plattform, eine Wanderausstellung, Angebote für Schulen und zahlreiche weitere Aktivitäten gehören, sind Beiträge des Bundes dazu.
Viele Betroffene können sich nicht vorstellen, im Alter in ein Altersheim zu gehen, weil sie schlechte Erfahrungen mit Institutionen gemacht haben. Auch ihre Kinder und Enkelkinder sind oft stark geprägt von den Erlebnissen, auch wenn die Betroffenen selbst nie darüber gesprochen haben. Auf dieser Web-Plattform finden Sie unter anderem eine Übersicht über die verschiedenen Unterstützungsangebote für Betroffene, sowie Hinweise für Fachpersonen im Sozial- und Gesundheitswesen.
Auch heute gibt es Zwangsmassnahmen und ausserfamiliäre Unterbringungen, wie Fremdplatzierungen heute heissen. Doch die Rechtslage und die Rechtsprechung haben sich seit den 1980er-Jahren in der Schweiz weiterentwickelt.
Im Kindes- und Erwachsenenschutz stehen heute die Betreuung, die Unterstützung und der Schutz von hilfsbedürftigen Personen im Zentrum.
Wenn das Wohl eines Kindes gefährdet ist und seine Eltern aus eigener Kraft keine Verbesserung erreichen können, greift die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) zur mildest möglichen Unterstützungsmassnahme. Es geht dabei nicht darum, den Eltern die Verantwortung zu entziehen, sondern darum, gemeinsame Lösungen zu finden. Das Kind wird nur als letztmögliche Massnahme ausserhalb seiner Familie untergebracht.
Für Erwachsene gibt es verschiedene Formen von Beistandschaften, um sie bei der Bewältigung des Alltages zu unterstützen. Nur wenn eine Person an einer schweren psychischen Erkrankung oder einer geistigen Behinderung leidet oder schwer verwahrlost ist, kann sie in einer geeigneten Einrichtung untergebracht werden. Aber nur dann, wenn es nicht anders geht und eine mildere Massnahme nicht ausreicht.
Es gibt nicht nur zivilrechtliche Zwangsmassnahmen, sondern auch Massnahmen im Straf-, Asyl- und Ausländerrecht, die gegen den Willen der betroffenen Person ergriffen werden und ihre persönliche Freiheit einschränken.
Der Justizvollzug und die Soziale Arbeit sind transparenter und offener geworden, und die Rechte von Betroffenen, z.B. Beschwerdemöglichkeiten, wurden gestärkt. Doch ist die heutige Praxis weiterhin im Wandel und steht vor vielfältigen Herausforderungen. Die Wahrung der Menschenwürde und der Rechtsstaatlichkeit sind dabei von höchster Wichtigkeit.
Die Auseinandersetzung mit der Geschichte zeigt: Immer, wenn eine Gesellschaft in das Leben ihrer Mitglieder eingreift, entsteht eine Spannung zwischen Hilfe und Kontrolle. Wer gilt als unterstützungs- oder schutzbedürftig? Wie weit können wir selbst über unser Leben bestimmen? Welche Rechte haben wir und wie stellen wir sicher, dass sie eingehalten werden? Und wo greift der Staat ein? Diese Fragen müssen wir weiterhin stellen und diskutieren.