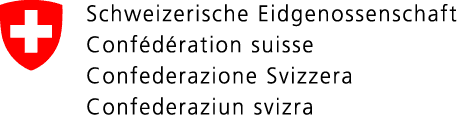Aufarbeitung im internationalen Kontext
Fürsorgerische Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen gab es nicht nur in der Schweiz, sondern auch in vielen anderen Ländern. Auch dort wird das historische Unrecht aufgearbeitet, wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Dabei zeigt sich: Die Erfahrungen der Betroffenen und die Machtstrukturen, die den Massnahmen zugrunde lagen, ähnelten sich in vielerlei Hinsicht.

Bereits in den 1990er-Jahren setzten sich Länder wie beispielsweise Australien, Kanada oder Irland mit der Problematik fürsorgerischer Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen auseinander. In Australien und Kanada rückte das Schicksal indigener Kinder in den Fokus, die ihren Familien entrissen wurden, um sie zur Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft zu zwingen. In Irland wiederum standen die sogenannten «Magdalenenheime» im Brennpunkt. Es wurden vor allem die Verfehlungen der katholischen Kirche untersucht, die eine zentrale Rolle spielte.

Unterrichtszeit an der römisch-katholischen Indian Residential School in Denı́nu Kų́ę́ (Fort Resolution), Northwest Territories in Kanada.
Eine der vielen sogenannten «Residential Schools» in Kanada, in welche «indigene» Kinder geschickt wurden, um sie von ihrer Herkunftskultur zu lösen und stattdessen anhand christlich-europäischer Werte zu erziehen.

Wäscherinnen in einem Magdalenenheim in England im frühen 20. Jahrhundert.
Magdalenenheime, auch Magdalenewäschereien genannt, waren Einrichtungen, in welchen Frauen (ledige Mütter, Sexarbeiterinnen, Opfer von Vergewaltigungen, Suchtkranke) gegen ihren Willen festgehalten und zur Arbeit gezwungen wurden. Ihre Kinder wurden häufig zur Adoption freigegeben.
Bild: unbekannt. Quelle: Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11187106.
Auch in England, Norwegen, Schweden, den Niederlanden, Belgien, Deutschland und Österreich rückten in der Folge Missstände in Kinderheimen sowie Missbrauchsfälle fremdplatzierter Kinder in den Blick. Einen Anstoss für diese Aufarbeitungsprozesse gab unter anderem die UN-Kinderrechtskonvention von 1990, die betont, dass Kinder ein Recht auf Schutz haben und angehört werden müssen.
Ähnliche Erfahrungen Betroffener
Obwohl es zwischen Ländern und Regionen Unterschiede in der institutionellen Organisation gab, sind die Gewaltformen, Machtstrukturen und Erfahrungen der Betroffenen vergleichbar. Unzählige Menschen erlitten in Heimen und Anstalten Missbrauch und Gewalt, wurden zur Arbeit gezwungen und ausgebeutet. Familiäre Bindungen wurden zerstört. Viele Betroffene leiden bis heute unter den Folgen wie zum Beispiel unter posttraumatischen Belastungsstörungen oder gesundheitlichen Langzeitfolgen. Ebenfalls länderübergreifend zeigt sich, dass die Betroffenen meist aus sozial und wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen stammten. Die Massnahmen befreiten sie oft nicht daraus, sondern führten beispielsweise dazu, dass sie geringere Bildungsabschlüsse erlangten und als Spätfolge weiterhin in prekären Verhältnissen leben.
Wege der Aufarbeitung und Anerkennung
In der Regel stützen sich die Aufarbeitungsprozesse auf mehrere Pfeiler. Es werden wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt, finanzielle Beiträge ausgerichtet und psychologische Unterstützung angeboten. Auch sprechen Regierungen und verantwortliche Institutionen Entschuldigungen aus. Vermittlungsprojekte sorgen dafür, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Berichte von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen einer breiten Bevölkerung bekannt werden. Die Schweiz begann mit diesem Aufarbeitungsprozess im internationalen Vergleich spät, im Vergleich mit anderen Staaten ist die schweizerische Aufarbeitung hingegen umfassend. Das heisst, sie beschränkt sich nicht auf einzelne Formen von Zwangsmassnahmen oder einzelne Gruppen von Betroffenen, zum Beispiel ehemalige Pflege- und Heimkinder, sondern zieht etwa auch die administrative Versorgung, die Zwangsadoptionen, die Zwangsabtreibungen oder -sterilisationen und Personen, die Zwangsmedikation oder Medikamentenversuchen ausgesetzt waren, mit ein.

Eine andere Form des kritischen Umgangs mit der eigenen Vergangenheit stellten Wahrheits- und Versöhnungskommissionen dar. Solche wurden etwa Mitte der 1990er-Jahre in Südafrika nach dem Ende der Apartheid ins Leben gerufen. Betroffene konnten ihre Erlebnisse schildern, Gewaltstrukturen wurden offengelegt und es kam zu Begegnungen zwischen Opfern und Tatpersonen. Auf diese Weise sollte der Weg in eine demokratische Gesellschaft geebnet werden. Darüber hinaus entstehen neue Initiativen, um Unrecht aufzuarbeiten und anzuerkennen. Mit der «Justice Initiative» wurde von der Guido Fluri Stiftung gemeinsam mit Opfergruppen, Betroffenenorganisationen und Forschenden aus Europa eine neue politische Initiative lanciert. Diese setzt sich für eine europaweite Aufarbeitung des Missbrauchs an Kindern und einen verbesserten Kindesschutz ein.
Weil seit einigen Jahren in vielen Staaten ähnliche Aufarbeitungsprozesse stattfinden, ist auch die Rede von einem «age of inquiry», also einer «Epoche der Nachforschung». Viele Länder bemühen sich um eine Veränderung ihrer Erinnerungskultur. Dabei geht es um einen kritischen Blick auf die Vergangenheit. Menschen, die früher systematisch an den Rand gedrängt und benachteiligt wurden, sollen zu Wort kommen und einen Platz im gemeinsamen kulturellen Gedächtnis erhalten.